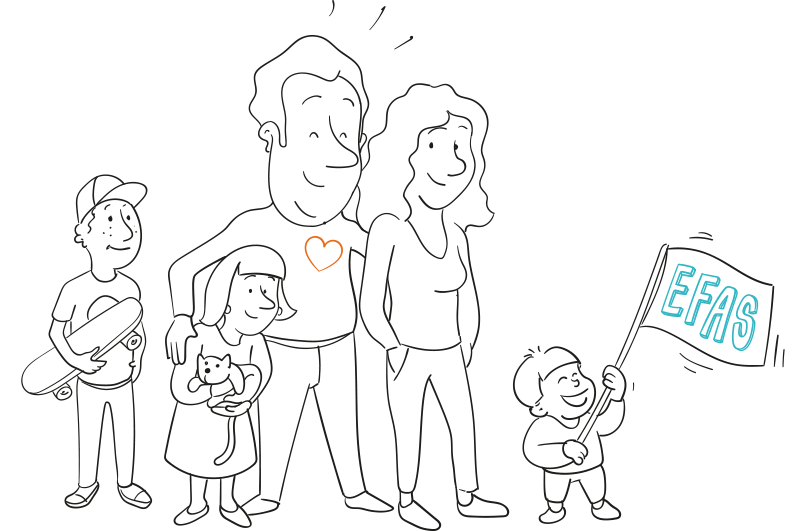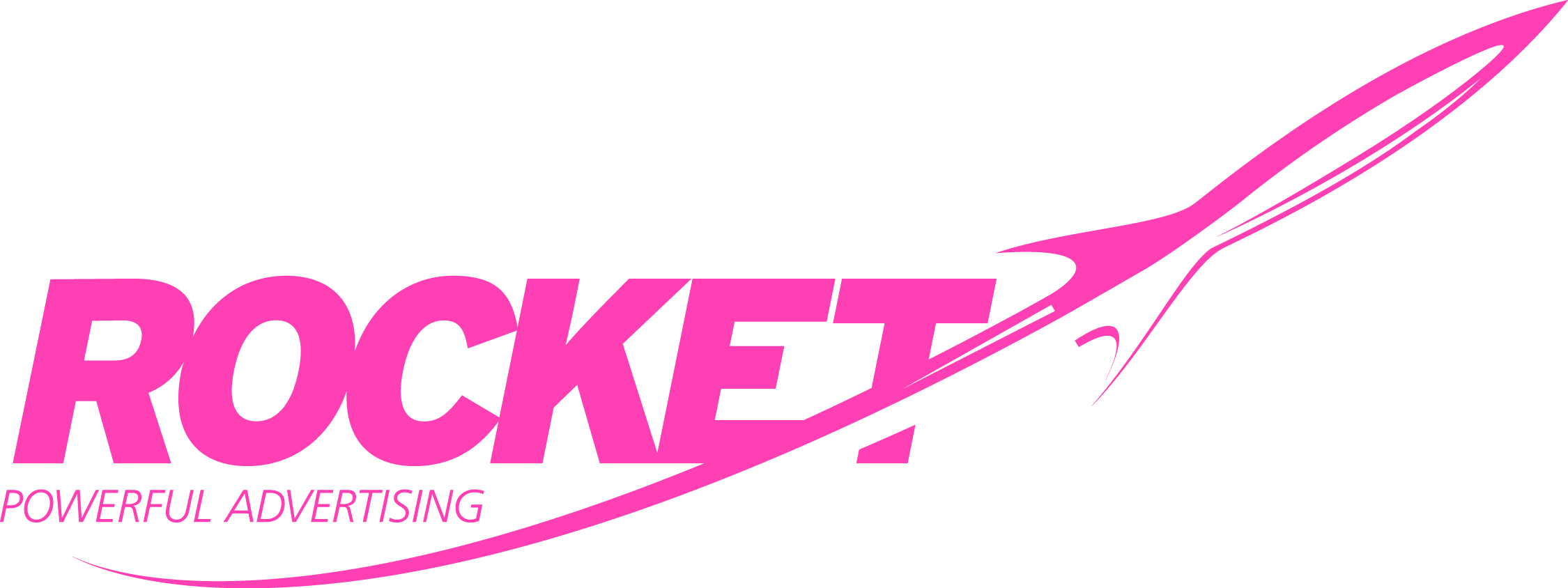Hier finden Sie Fakten zur einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen EFAS und verschieden Studien, welche den Überlegungen zur Wirkung von EFAS zugrunde liegen.
Faktenblatt EFAS
Warum die Einführung der «Einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen» (EFAS) eine wichtige Reform ist
Es liegt in der Verantwortung aller Akteure im Gesundheitswesen, sich gemeinsam dafür einzusetzen, dass die medizinische Grundversorgung in der Schweiz auch in Zukunft qualitativ hochstehend und finanzierbar ist. Gefragt sind vor allem Massnahmen, welche die Kostensteigerung nachhaltig dämpfen. Gute Ansatzpunkte zur Effizienzsteigerung finden sich dort, wo finanzielle Fehlanreize im heutigen System bestehen. Diese haben Fehl- und Überversorgung zur Folge. Das kostet unnötig viel Geld, und dies erst noch zum Schaden der Patientinnen und Patienten. Ein solcher Fehlanreiz im heutigen System ist die ungleiche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP). Stationäre Leistungen werden von den Krankenversicherern (45 %) und Kantonen (55 %) gemeinsam getragen. Ambulante Leistungen hingegen werden zu 100 % über Prämien finanziert. Der Entscheid über eine Behandlung soll aus medizinischer und patientenorientierter Sicht getroffen werden und nicht von finanziellen Fehlanreizen beeinflusst sein. Mit EFAS, der einheitlichen Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen, ist die Finanzierung weiterhin durch Steuern und Prämien getragen (Mittelherkunft dual), der Mitteleinsatz beim Leistungserbringer jedoch künftig einheitlich – unabhängig, ob Leistungen stationär oder ambulant erbracht werden.
Studien und Berichte rund um EFAS
Beitrag im Competence vom 4. April 2024, Schweizer Forum für integrierte Versorgung
EFAS und Integrierte Versorgung – Zukunft beginnt bereits heute
Eine zentrale Aufgabe bei der Umsetzung der einheitlichen Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen ist es, die Potenziale von EFAS zu nutzen, um die Integrierte Versorgung zu fördern. (…)
Beitrag im Standpunkt der Helsana vom August 2023
Eine breite EFAS-Allianz
Wenn sich bei einem Thema alle massgeblichen Stakeholder im Gesundheitswesen und sogar der Bundesrat einig sind, dann ist es hier der Fall. Im «Standpunkt» haben wir einige der Stakeholder gebeten, kurz und knapp darzulegen, wieso sie für EFAS einstehen. Es gibt da offensichtlich viele Gründe, nicht nur die Kosten.
Bericht des Bundesamts für Gesundheit vom 15. August 2023
Zukünftige Entwicklung Prämien- und Steuerfinanzierung mit oder ohne Einbezug der Pflegeleistungen
Die Verwaltung wurde von der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) an ihrer Sitzung vom 3. Juli 2023 beauftragt, nochmals die finanziellen Auswirkungen der verschiedenen Szenarien (einheitliche Finanzierung mit oder ohne Pflege, Weiterführung des Status quo) aufzuzeigen und dabei auch auf die Einschätzungen von Santésuisse zu diesem Thema einzugehen, die am 28. Juni 2023, kurz vor der Sitzung der SGK-N, veröffentlicht worden waren. (…)
Das EDI und das BAG kamen in ihren Berichten vom 30. November 2020 und 5. Januar 2022 gestützt auf eine Studie von Infras (2019) zur Ansicht, dass eine Weiterführung des Status quo aus Prämiensicht am teuersten wäre und eine einheitliche Finanzierung ohne Pflegeleistungen am günstigsten, während sich bei einer einheitlichen Finanzierung mit Pflege die Belastung von Prämien- und Steuerfinanzierung ausgeglichen entwickeln würde. (…)
Bericht des Bundesamts für Gesundheit vom 7. März 2023
Auswirkungen einer einheitlichen Finanzierung der Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
Bericht des Eidgenössischen Departements des Innern vom 30. November 2020
Bericht über die Auswirkungen einer einheitlichen Finanzierung der Leistungen im ambulanten und stationären Bereich
Anlässlich der Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates (SGK-S) vom 11. Februar 2020 wurde das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) beauftragt, einen Bericht zu erstellen, in welchem verschiedene offene Fragen in Zusammenhang mit einer einheitlichen Finanzierung beleuchtet werden.
Dazu gehören namentlich Fragen zum Einbezug der Langzeitpflege in eine einheitliche Finanzierung und die Entwicklung der Finanzflüsse bei den verschiedenen Optionen, zu den Steuerungsmöglichkeiten der Kantone, zur Berechnung des Kantonsbeitrags und dessen Aufteilung auf die Versicherer, zu Tarifstrukturorganisationen, zum technischen Ablauf der Finanzierung sowie zur Rechnungs- und Wohnsitzkontrolle, zum Umgang mit Vertragsspitälern, zum Kostendämpfungspotenzial und zur koordinierten Versorgung (…)
Gutachten Polynomics (im Auftrag von CSS, Helsana und Swica), 2018
Kosteneinsparungen durch EFAS
Die Resultate der Berechnungen zeigen, dass im heutigen System Nettoeinsparungen durch integrierte Versorgung in der Grössenordnung von 200 CHF pro HMO-Versicherter in diesen Modellen resultieren, welche unter EFAS nicht mehr beim Kanton, sondern bei den Krankenversicherern anfallen würden. Durch die Einführung von EFAS könnten die Versicherungsprämien von HMO-Versicherten damit um rund 6 % reduziert werden, was einer Erhöhung der heutigen Rabatte um rund 20 % entspricht.
Studie ZHAW (Resultate), 2016
Wie wirkt sich eine einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen auf Effizienz und Versorgungsqualität aus?
Das Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie (WIG) der ZHAW wurde von curafutura mit einer Studie zu den qualitativen und quantitativen Auswirkungen einer «einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen» (EFAS) beauftragt. Zusammen mit Expertinnen und Experten ist dazu ein Wirkungsmodell entwickelt worden, welches die Zusammenhänge zwischen der Einführung von EFAS und der Effizienz sowie Qualität der medizinischen Leistungserbringung aufzeigt. Die Studie kommt zum Ergebnis, dass EFAS eine positive Wirkung auf diese beiden Grössen attestiert werden kann, die sich im Zeitverlauf in Wechselwirkung mit anderen Grössen manifestiert.
Studie pwc, 2016
Ambulant vor stationär. Oder wie sich eine Milliarde Franken jährlich einsparen lassen.
Der Trend zur Verlagerung von Leistungen vom stationären in den ambulanten Sektor wird weitergehen. Fortschritte in der Medizin und die Bedürfnisse der Patienten sind die Haupttreiber dieser Entwicklung. Im aktuellen Finanzierungs- und Tarifsystem der Schweiz bestehen Fehlanreize. Aus diesem Grund werden viele Eingriffe nicht ambulant durchgeführt, auch wenn es medizinisch möglich wäre. Stationäre Eingriffe sind in der Regel teurer als ambulante. Deshalb lassen sich erhebliche Kosten einsparen, wenn Operationen verstärkt in den ambulanten Bereich verlegt werden. Im internationalen Vergleich hinkt die Schweiz hinterher.
Studie Huber, C. A., Reich O., et al. 2016
Effects of Integrated Care on Disease-Related Hospitalisation and Healthcare Costs in Patients with Diabetes, Cardiovascular Diseases and Respiratory Illnesses: A Propensity-Matched Cohort Study in Switzerland
Integrierte Versorgung trägt zu tieferen Kosten und besserer Qualität bei der Behandlung von chronisch Kranken bei – diese Erkenntnis ist insbesondere vor dem Hintergrund einer alternden und zunehmend chronisch- bzw. multimorbiden Bevölkerung zentral. Denn diese Patientengruppe verursacht 80 % der Kosten. In der Studie konnte nachgewiesen werden, dass durch integrierte Versorgung 8 bis 13 Prozent weniger Spitalaufenthalte bei Diabetikern und Herzpatienten notwendig waren.
Studie Akademien der Wissenschaften samw, 2012
Effizienz, Nutzung und Finanzierung des Gesundheitswesens
Die mangelnde Koordination zwischen den Leistungserbringern führt zu Überversorgung. Diese manifestiert sich unter anderem in doppelten Untersuchungen und Behandlungen, überflüssigen Arztbesuchen und fehlerhaften Behandlungen. Die Studie schätzt die Ineffizienz aufgrund von mangelnder Koordination in der ambulanten und stationären Versorgung (inkl. Medikamentenabgabe) auf 3 Milliarden Franken jährlich.